Rechtliches
Lebenswerke weitergeben – Lebenswerke neu beginnen
Sie haben nun schon viele wichtige Informationen zur Hofübergabe, Neugründung oder Kooperation gesammelt. Nun fragen Sie sich, wenn alle anderen Fragen geklärt sind, welche Unternehmensform passt zu uns? Welche Möglichkeiten zur Versicherung gibt es, auch während eines Praktikums? Muss ich eine Grundsteuer entrichten und was unterliegt der Anzeigepflicht ans Finanzamt?
Finden Sie Ihre Kategorie:
Wer darf einen Hof kaufen/übernehmen – Grundverkehrsgesetz in Österreich
Grundsätzlich ist für die Tätigkeit als Bäuerin oder Bauer keine Formalqualifikation erforderlich. Nur der Erwerb von Bauernhöfen oder landwirtschaftlichen Flächen kann grundverkehrsbehördlich bewilligungspflichtig sein. Diese Regelungen dienen dem Schutz vor Spekulation und der Sicherstellung der flächendeckenden Bewirtschaftung des ländlichen Raumes. Daher kontrollieren die Grundverkehrskommissionen Kauf und Verkauf landwirtschaftlicher Flächen.
Höfe sollten im Sinne der Ernährungssicherheit und des Erhaltes unseres Landschaftsbildes Verwendung finden und nicht als Ferienhaus oder brachliegendes Spekulationsobjekt enden. Das Grundverkehrsgesetz liegt im Einflussbereich der Bundesländer und wird jeweils unterschiedlich gehandhabt. Somit hängt es vom jeweiligen Standort ab, welche Ausbildungsnachweise für den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen vorausgesetzt werden.
Der sogenannte grüne Grundverkehr betrifft land- und forstwirtschaftliche Flächen, über deren Kauf und Verkauf die Grundverkehrskommission des jeweiligen Bundeslandes entscheiden muss. Auch der Ausländer*innen-Grundverkehr ist in allen österreichischen Bundesländern genehmigungspflichtig. In einigen Bundesländern müssen potentielle Käuferinnen und Käufer über eine land- oder forstwirtschaftliche Schul- oder Berufsausbildung verfügen, sowie praktische Tätigkeit in der Land- oder Forstwirtschaft aufweisen. Außerdem kann die Selbstbewirtschaftung des Kaufobjektes verpflichtend sein. Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens ist nachzuweisen, dass ein entsprechendes landwirtschaftliches Einkommen erzielt wird. Dazu ist meist die Vorlage eines schlüssigen Bewirtschaftungskonzeptes erforderlich.
Neben dem Antrag auf grundverkehrsbehördliche Genehmigung bieten die meisten Grundverkehrsbehörden auch die Möglichkeit an, einen Feststellungsbescheid zu beantragen. Dieser gibt Auskunft darüber, ob die vertragsgegenständliche Liegenschaftstransaktion einer Genehmigung bedarf oder nicht.
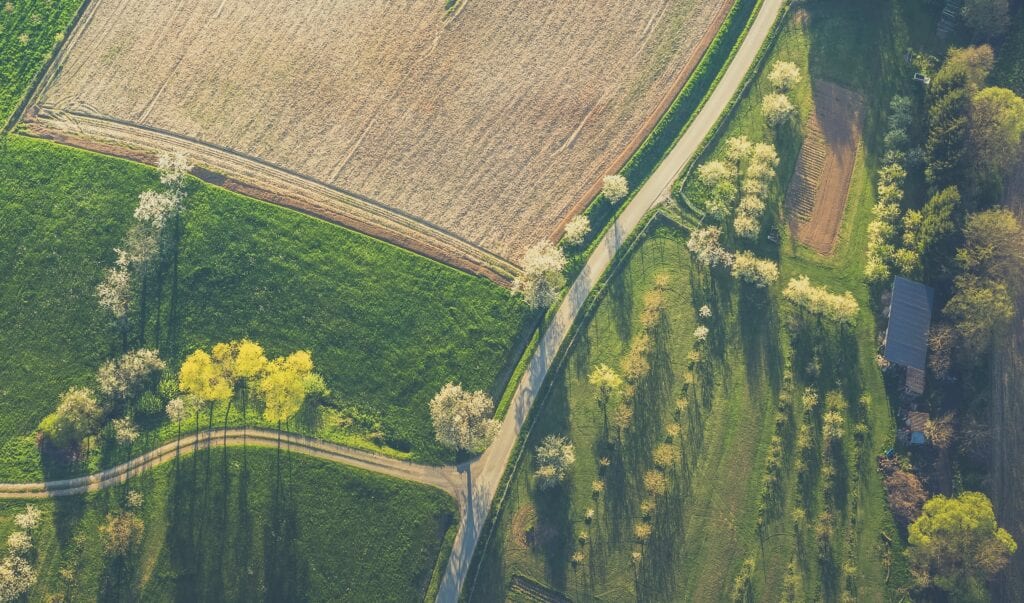
Zu beachten: Es empfiehlt sich, unabhängig vom Bundesland, den Fall vor Vertragsabschluss und vor Einreichung bei der Grundverkehrskommission prüfen zu lassen. Wenden Sie sich dazu an Ihre Bezirkshauptmannschaft! Damit schützen Sie sich vor dem Risiko einer Abweisung durch die Grundverkehrskommission auf Bezirksebene. Lassen Sie sich von den Anforderungen nicht verunsichern, aber fragen Sie nach und nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit der Bezirkshauptmannschaft auf.
Oberösterreich
Grundsätzlich werden die Genehmigungsvoraussetzungen für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen von den Grundverkehrskommissionen im Einzelfall bezogen auf das jeweilige Bewirtschaftungskonzept geprüft. Es besteht jedoch eine informelle Übereinkunft der Behörden in Oberösterreich, dass bei kleinen Grünland-Liegenschaften bis ca. 1,5 – 2 ha mit extensiver Grünlandbewirtschaftung ohne Tierhaltung üblicherweise ein Basiskurs des LFI (Ländliches Fortbildungsinstitut) von den Grundverkehrsbehörden als ausreichende Ausbildung angesehen wird.
Bei Flächen über drei Hektar wird eine Fachausbildung vorausgesetzt, diese kann an einer landwirtschaftlichen Fachschule (Link: https://www.lehrlingsstelle.at/) erfolgen, bzw. der Nachweis einer mindestens zweijährigen praktischen (beruflichen) Tätigkeit in der Land- oder Forstwirtschaft. Dies ergibt sich aus § 4 Abs. 3 Oö. Grundverkehrsgesetz 1994. Ferienaufenthalte am Bauernhof oder gelegentliche Mithilfe auf landwirtschaftlichen Betrieben in der Verwandtschaft/Nachbarschaft werden nicht angerechnet.
Zu grundsätzlichen Fragen Rund um das Thema Grundverkehr bietet das Land Oberösterreich auf seiner Internetseite einige Basisinformationen an: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/47212.htm
Steiermark
In der Steiermark wird eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung dann angenommen, wenn die/der Bewirtschaftende über eine land- oder forstwirtschaftliche Schul- bzw. Berufsausbildung in Österreich oder eine gleichwertige Ausbildung im Ausland verfügt oder eine mindestens zweijährige praktische Tätigkeit in der Land- oder Forstwirtschaft aufweist. Eine praktische Tätigkeit ist dann gegeben, wenn die/der Bewirtschaftende innerhalb eines zusammenhängenden Zeitraums von zwei Jahren einer selbstständigen land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeit nachging oder als land- oder forstwirtschaftliche/r Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer jährlich mindestens acht Monate tatsächlich gearbeitet hat.
Nähere Details über die Ausbildung sind dem Gesetz nicht zu entnehmen, es hängt weitgehend von der Auslegung Ihres Falles ab, welche Ausbildung etc. als ausreichend empfunden wird. Detaillierte rechtliche Informationen zum Grundverkehrsgesetz im Land Steiermark findet sich im Rechtsinformationssystem: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000924
Niederösterreich
Für die Genehmigung eines Grunderwerbs von mehr als ca. 0,3 Hektar Fläche in Niederösterreich müssen Neueinsteiger*innen durch ein Betriebskonzept nachweisen, dass sie 25 % ihres Gesamteinkommens am Betrieb erwirtschaften. Zusätzlich müssen eine fachliche Ausbildung und entsprechende Praxis in der Land- und Forstwirtschaft nachgewiesen werden. Für die fachliche Ausbildung reicht die Facharbeiter*innenausbildung im zweiten Bildungsweg.
Diese umfasst in Niederösterreich 200 Unterrichtseinheiten, die Kurse werden in den landwirtschaftlichen Fachschulen angeboten. Für die Aufnahme ist Voraussetzung, dass das 20. Lebensjahr vollendet ist und insgesamt eine mindestens zweijährige praktische Tätigkeit in dem jeweiligen Zweig der Land- und Forstwirtschaft nachgewiesen wird.
Kärnten
Nach dem Kärntner Grundverkehrsgesetz gilt als Landwirt*in, wer nach Erwerb des Betriebes oder von Grundstücken in gleicher Weise tätig sein will, sofern er/sie aufgrund praktischer Tätigkeit oder fachlicher Ausbildung die hierzu erforderlichen Fähigkeiten besitzt. Als fachliche Ausbildung gilt jedenfalls die Absolvierung einer landwirtschaftlichen Fachschule oder eines landwirtschaftlichen Facharbeiter*innenkurses. In Einzelfällen reichen auch andere Ausbildungen, wie z. B. beim Erwerb von Waldgrundstücken die Absolvierung eines Lehrganges bei der Forstlichen Ausbildungsstelle in Ossiach.
Der Verwaltungsgerichtshof hat jedoch festgehalten, dass eine 15-monatige Tätigkeit als landwirtschaftliche Hilfskraft zum Nachweis der erforderlichen fachlichen Befähigung zur Bewirtschaftung nicht ausreicht. Die Beurteilung, welche Ausbildung für den konkreten Erwerb erforderlich ist, trifft das sachverständige Mitglied bei der Grundverkehrskommission. Das sind in der Regel die Regionalbüroleiter*innen der Abteilung 10 des Amtes der Kärntner Landesregierung, hier der Link zur Website des Landes Kärnten mit Kontakt zu den Bezirkshauptmannschaften: https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/BW-L1
Tirol
Dem Grundverkehrsgesetz kommt im Bundesland Tirol aufgrund der sehr knappen intensiv nutzbaren Flächen besondere Bedeutung zu. Für den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen ist eine Qualifikation als Landwirt*in bzw. als „Neueinsteiger*in“ erforderlich. Unter Neueinsteiger*in versteht das Tiroler Grundverkehrsgesetz jemanden, der/die nach dem Erwerb eines landwirtschaftlichen Betriebes oder eines landwirtschaftlichen Grundstückes eine Tätigkeit wie ein/e Landwirt*in ausüben will und die dazu erforderlichen Fähigkeiten aufgrund seiner/ihrer praktischen Tätigkeit oder fachlichen Ausbildung nachweisen kann.
Als erforderliche Qualifikation kann bspw. die Ausbildung zum/r landwirtschaftlichen Facharbeiter*in oder Meister*in angesehen werden. Bei der Beurteilung der Qualifikation als Neueinsteiger*in bzw. Landwirt*in oder der ausreichenden praktischen Tätigkeiten wird die zuständige Bezirkslandwirtschaftskammer tätig. Außerdem muss die Absicht der nachhaltigen ordnungsgemäßen Bewirtschaftung durch ein Betriebskonzept glaubhaft gemacht werden. Nähere Infos zum Grundverkehr in Tirol finden Sie hier: https://www.tirol.gv.at/schwaz/formulare/formulare-grundverkehr/
Salzburg
Damit ein Grunderwerb von der Salzburger Grundverkehrskommission genehmigt wird, muss ein/e Landwirt*in nachweisen, mind. 20% des Einkommens durch den Betrieb zu erwirtschaften. Neueinsteiger*innen müssen durch ein Betriebskonzept nachweisen, ebenso viel Einkommen aus der Landwirtschaft zu erzielen, den Betrieb selbst zu bewirtschaften oder bewirtschaften zu lassen. Als Ausbildung wird die Ausbildung zum/zur Facharbeiter*in, die landwirtschaftliche Matura, die landwirtschaftliche Schulausbildung oder ein
Universitätsabschluss im Bereich Landwirtschaft anerkannt. Wird diese an die Ausbildung gekoppelte Bedingung nicht erfüllt, muss anderweitig glaubhaft gemacht werden, dass man Erfahrungen in der Landwirtschaft gesammelt hat. Dies wird einzelfallbezogen entschieden, günstig ist in jedem Fall eine mehrjährige Tätigkeit als Betriebsleiter*in. Hier informiert das Land Salzburg zum Grundverkehr: https://www.salzburg.gv.at/agrarwald_/Seiten/grundverkehr.aspx
Wien
In Wien gibt es im im Gegensatz zu den anderen österreichischen Bundesländern kein landwirtschaftliches Grundverkehrsgesetz. Ein solches Gesetz wurde vom Bundesland Wien, aufgrund der überschaubaren landwirtschaftlichen Fläche nie erlassen. Ein Erwerb landwirtschaftlich genutzter bzw. gewidmeter Grundflächen ist daher im Bundesland Wien auch durch „Nichtlandwirte“ jederzeit möglich und unterliegt auch keiner agrarbehördlichen Genehmigungspflicht.
Womit Wien seine landwirtschaftlichen Flächen dennoch zu schützen versucht, ist das agrartechnische Gutachten:
Für die Bebauung landwirtschaftlicher Flächen kann ein agrartechnisches Gutachten angefordert werden, das feststellt, ob eine Bebauung landwirtschaftlichen Zwecken dient oder nicht. Wenn eine neu errichtete Bebauung, z.B. ein Schwimmbad oder eine Autogarage, keinen landwirtschaftlichen Zweck erfüllt, muss sie wieder entfernt werden. Zu diesem Zweck muss die Flächenwidmung und die in der Wiener Bauordnung (BO) festgelegten Bestimmungen beachtet werden.
Weitere Infos zur Bauordnung in Wien finden sie unter: https://www.wien.gv.at/bauen/richtlinien/index.html
Burgenland & Vorarlberg
Im Burgenland und in Vorarlberg werden für einen Grunderwerb keine spezifischen Bedingungen in Bezug auf die Ausbildung gestellt, dafür gibt es andere Voraussetzungen:
Weitere rechtliche Informationen zur Grundverkehrsordnung im Land Burgenland finden sich im Rechtsinformationssystem unter: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrBgld&Gesetzesnummer=20000615 Ausführliche Informationen zur rechtlichen Lage und Situation in Vorarlberg finden sich auf der Seite des Landes Vorarlberg: https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/grundverkehr?article_id=240289

Bin ich ein/e Neueinsteiger*in?
Wer in den letzten 15 Jahren vor der Übernahme nicht als Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter den zu übernehmenden Hof (z.B. als Pächter) oder einen anderen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr bewirtschaftet hat, gilt als Neueinsteiger*in. Weitere Voraussetzung für die Abgabenvergünstigung ist, dass die Übernehmenden den Betrieb zumindest fünf Jahre nach der Übergabe fortführen. Wenn Sie die Voraussetzungen für das NeuFöG erfüllen, ist eine Hofübergabe aufgrund der steuerrechtlichen Begünstigungen einer Verpachtung vorzuziehen.
Zu Beachten: Die Erklärung der Betriebsübertragung muss unter vorheriger Inanspruchnahme einer Beratung durch die gesetzliche Berufsvertretung (Bezirksbauernkammer) erfolgt sein. Bereits vor Vertragsunterzeichnung muss die NeuFöG 2-Bestätigung bei der zuständigen Bezirksbauernkammer vorliegen. Die dazu benötigten Formulare finden Sie unter www.bmf.gv.at
Unternehmensform für die gemeinsame Bewirtschaftung
Wenn Sie den Hof alleine oder zu zweit führen wollen, stellt sich die Frage nach der Unternehmensform meistens nicht. In Österreich werden die meisten Höfe als Einzelunternehmen, gemeinsam als Ehepaar oder von Familienangehörigen als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR) geführt. Wenn Sie allerdings planen, den Hof gemeinsam mit mehreren Personen als Gruppe zu führen, stellt sich die Frage nach der geeigneten Rechtsform. Eigentum und Bewirtschaftung sind zu unterscheiden.
Als Beispiel: Eine Gruppe junger Landwirt*innen organisiert sich als GmbH und ist zugleich Eigentümer*in und Bewirtschafter*in eines Hofes. Genauso gut kann sich aber der Hof im Eigentum einer Stiftung befinden, die einen Nutzungsvertrag mit der GmbH als Bewirtschafterin abschließt, zu der sich die Gruppe zusammengeschlossen hat.
Im Folgenden stellen wir Unternehmensformen vor, die für die Organisation eines landwirtschaftlichen Betriebes in Frage kommen.
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR)
Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts entsteht dann, wenn sich zwei oder mehrere Personen (nicht unbedingt Familienangehörige) vertraglich zusammenschließen, um gemeinsam zu wirtschaften. Da es für das Entstehen einer GesbR keine gesetzlichen Formvorschriften gibt, kann sie sogar mündlich oder stillschweigend abgeschlossen werden. Allerdings ist ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag in jedem Fall anzustreben.
In einem Gesellschaftsvertrag werden die gegenseitigen Rechte und Pflichten festgelegt. Eine GesbR hat keine Rechtspersönlichkeit, daher tragen die einzelnen Gesellschafter*innen Rechte und Pflichten nach dem Gesellschaftsvertrag. Die GesbR kann weder eine Firma führen, noch im Grundbuch eingetragen werden.
Offene Gesellschaft (OG)
Eine Offene Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Gesellschafter*innen und entsteht durch die Eintragung ins Firmenbuch und ist eine rechtsfähige Personengesellschaft. Sie kann jeden erlaubten Zweck verfolgen, einschließlich freiberuflicher und land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit. Alle Gesellschafter*innen der OG haften wie bei der GesbR in vollem Umfang für aufkommende Schulden des Unternehmens mit ihrem Privatvermögen.
Im Gegensatz zur GesbR muss die OG durch die Eintragung ins Firmenbuch die Geschäftsführer- und Vertretungsverhältnisse sowie eine umfassende Rechtsfähigkeit offenlegen. Die OG kann Rechte erwerben, Kredite aufnehmen, klagen und geklagt werden und kann auch Gewerberechtsträger*in sein. Gegenüber der GesbR ist die OG mit mehr Regelwerk und Vorschriften verbunden, was aber auch mehr Rechtssicherheit bedeutet. Diese Rechtsform eignet sich speziell für Unternehmen, deren Tätigkeit sich in überschaubarem Rahmen abspielt.
Kommanditgesellschaft (KG)
Die KG kennt im Gegensatz zur OG zwei unterschiedliche Arten von Gesellschafter*innen. Der/die Komplementär*in als persönlich haftende/r Gesellschafter*in haftet uneingeschränkt für Schulden und Verbindlichkeiten, er ist in aller Regel auch Geschäftsführer*in der KG. Die Kommanditist*innen überlassen der Gesellschaft beispielsweise Flächen, Kapital oder Gebäude zur Nutzung, bringen Maschinen oder ihre Arbeitskraft in die KG ein, haben aber nur beschränkte Mitspracherechte und haften nur in Höhe ihrer Kapitaleinlage.
Die Haftung des/der Kommanditist*in ist eingeschränkt. Falls sich bei landwirtschaftlichen Zusammenschlüssen nicht alle Partner*innen in gleicher Weise beteiligen und haften wollen, kann die KG eine sinnvolle Gesellschaftsform sein. Insbesondere für Landwirt*innen, die zwar die aktive Bewirtschaftung aufgeben oder deutlich reduzieren, aber ihren Betrieb nicht oder noch nicht an die Hofübernehmer*innen verpachten wollen, kann diese Rechtsform interessant sein.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GesmbH)
Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft und als juristische Person rechtsfähig. Seit 2013 kann mit 10.000 Euro statt mit bis dahin 35.000 Euro Stammkapital eine GmbH gegründet werden. Die GmbH entsteht mit der Eintragung ins Firmenbuch. Für die Errichtung des Gesellschaftsvertrages, die Gesellschaftsgründung, Vertragsänderungen und sonstige wichtige Akte besteht Notariatsaktspflicht, was die GmbH aufwendig und teuer macht. Der Vorteil liegt darin, dass grundsätzlich keine persönliche Haftung der Gesellschafter*innen besteht.
Das Risiko der einzelnen Gesellschafter*innen reduziert sich auf den Verlust der Stammeinlage, da für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nur mit dem Gesellschaftsvermögen gehaftet wird.
Eine GmbH empfiehlt sich vor allem für Projekte von sehr langer Dauer und großem Umfang, bei denen der Wechsel der Gesellschafter*innen nur in Ausnahmefällen vorkommen soll, und wenn ein größeres Haftungsrisiko besteht. Daher ist eine GmbH für die land- und forstwirtschaftliche Urproduktion im Regelfall nicht erforderlich.
Genossenschaft mit beschränkter Haftung (GenmbH)
Diese Rechtsform stellt eine juristische Person dar mit einer grundsätzlich nicht geschlossenen Mitgliederzahl, die den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder zu fördern hat. Für die Gründung einer Genossenschaft muss ein schriftlicher Genossenschaftsvertrag (Statut) erstellt werden. Anschließend muss ein Revisionsverband die Aufnahme zusichern, erst dann kann die Genossenschaft in das Firmenbuch eingetragen werden. Ein wesentlicher Vorteil der Genossenschaft besteht darin, dass bei Ein- und Austritt eines Mitgliedes keine Änderung der Satzung erforderlich ist, Ein- und Ausstieg sind daher flexibel. Die Genossenschafter*innen haften laut Gesetz grundsätzlich beschränkt mit ihrem Geschäftsanteil, im Insolvenzfall mit dem Doppelten des Geschäftsanteiles.
Ausscheidende Genossenschafter*innen haben jedoch keinen Anteil am Vermögenszuwachs der Genossenschaft.
Die Genossenschaft ist vor allem für Zusammenschlüsse mit zahlreichen Personen empfehlenswert und vor allem dann, wenn sie weiteren Interessent*innen offen stehen soll. Durch die Revision erhalten die Mitglieder wertvolle Informationen über die wirtschaftliche Lage der Genossenschaft. Im Jahr 2016 wurde in Österreich der Revisionsverband Rückenwind gegründet. Ziel ist es, die Genossenschaft als Rechtsform solidarischen Wirtschaftens zu stärken und zu fördern. Link: https://www.rueckenwind.coop/
Verein
Es gibt Hofprojekte, die den Verein zur Rechtsform haben. Gerade zu Beginn eines Projektes bietet ein Verein eine gute Möglichkeit, Formen der Entscheidungsfindung und Mitbestimmung auszutesten, da seine Errichtung und die Aufnahme neuer Mitglieder sehr einfach sind. Bei größerer wirtschaftlicher Aktivität sollten sich die Beteiligten aber im Klaren sein, dass ein Verein gerade durch seine Flexibilität eher geringe Rechtssicherheit bietet.
Was bringt die Mitgliedschaft in der Landwirtschaftskammer mit sich?
Die Landwirtschaftskammer (LK) ist die gesetzliche Vertretung der Land- und Forstwirt*innen in Österreich. Neben Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund ist die Landwirtschaftskammer Teil der Sozialpartnerschaft, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eingerichtet wurde.
Da die Zuständigkeit für die Landwirtschaftskammern in die Zuständigkeit der einzelnen Bundesländer fällt, gibt es neun eigenständige Landwirtschaftskammern, die jeweils unterschiedlich ausgestaltet sind. Die Mitgliedschaft ist eine Pflichtmitgliedschaft, ähnlich den anderen Kammern. Die Kammermitglieder haben ein Wahlrecht innerhalb der Kammer, wo Wahlen einzelner Mitglieder vorgesehen sind. Von diesem können Sie v.a. in der Wahl der Vollversammlung, die alle fünf Jahre stattfindet, Gebrauch machen. Je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Mindestanforderungen an die Betriebsgröße (z.B. in OÖ ab 2 ha).
Die Mitglieder der Landwirtschaftskammer zahlen als Mitgliedsbeitrag die Kammerumlage. Diese ist zweigeteilt in einen vom jeweiligen land- und forstwirtschaftlichen Einheitswert des Betriebes abhängigen Hebesatzbetrag und einen Grundbetrag. Die Vorschreibung erfolgt durch das Finanzamt mittels des Erlagscheines “Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben”, mit dem zeitgleich auch die Beiträge für Pensions-, Unfall- und Krankenversicherung eingehoben werden.
Zu den Aufgaben der Landwirtschaftskammer zählen u.a. Beratungs- Service- und Bildungsangebote, Erteilung von Auskünften und Stellungnahmen zu Gesetzen und Vorschriften und agrarpolitische Interessensvertretung auf nationaler und EU-Ebene.

Wer berät mich in rechtlichen und finanziellen Belangen?
Die Rechtsabteilungen der Landwirtschaftskammern der neun Bundesländer stehen Ihnen mit Ihrer Expertise zur Seite und entwickeln außerdem spezielle Angebote für Personen, die eine Hofübergabe planen und für Hofübernehmende.
- Bei der Grundberatung – Bäuerliche Hofübergabe/Hofübernahme (LK-Produkt) berät meist bei der/die Kammersekretär*in der jeweiligen BBK die Beteiligten zur Hofnachfolge. Je nach Bundesland und Berater*in dauert dieses kostenpflichtige Beratungsprodukt bis zu 5 Stunden. Im Vorfeld füllen die Beteiligten einen Fragebogen aus, während der Sitzung wird das 25-seitige Konzept der Hofnachfolge gemeinsam mit dem Berater, der Beraterin erarbeitet. Zum Abschluss bekommen die Beteiligten das Konzept in dreifacher Ausfertigung mit nach Hause, je eines für die, die ihren Hof übergeben, sowie Hofübernehmende und Notar*in. Es kann als Grundlage für den Hofübergabe-Vertrag verwendet werden. Sie wird gerne in Anspruch genommen, weil die Hofnachfolge dabei bis ins Detail besprochen wird
- Beim kostenpflichtigen Beratungsprodukt Hofübergabe (LK-Produkt) werden all jene, die ihren Hof übergeben wollen, als auch Hofübernehmende individuell zu ihrem Fall in Zivil- und Erbrecht, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht und Förderungen beraten. Es wird u.a. in Oberösterreich angeboten. Drei Jurist*innen und eine Person der Betriebsabteilung stehen dafür je etwa für eine Stunde zur Verfügung. Abschließend wird den Beteiligten innerhalb von maximal einem Monat ein Protokoll zugesandt.
- Die Rechtssprechtage / Steuersprechtage der Sozialversicherungsanstalt (SVS) werden je Kammergröße und Standort häufiger oder seltener angeboten. Die MitarbeiterInnen der SVS beraten auf den Bezirksbauernkammern.
- Von der LK werden zusätzlich Exkursionen angeboten, bei denen die Teilnehmer*innen Einblick in verschiedenste Betriebe erhalten und sich untereinander vernetzen können.
- Unternehmerische Kompetenzen: Die Initiative „Landwirtschaft 2020“ wurde vom Lebensministerium in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftskammern und den ländlichen Fortbildungsinstituten zur Stärkung unternehmerischer Kompetenz ins Leben gerufen. Die Kampagne „Mein Betrieb – Meine Zukunft“ soll Landwirt*innen unterstützen, Betriebskonzepte zu erarbeiten
Formen der Hofübergabe
Die Wahl der Rechtsform für eine Hofübergabe stellt wichtige Weichen für Form und Gestalt des künftigen Zusammenlebens. Eine Verpachtung des Gesamt- oder eines Teilbetriebs kann als Schritt in Richtung Übergabe gesehen werden, oder auch eine langfristige Lösung sein – dann, wenn man den familiären Erb*innen die Entscheidung über den Betrieb überlassen möchte.
Die Übergabe eines funktionierenden Betriebes an die nächste Generation ist letztlich meistens mit einem Eigentümerwechsel verbunden, der unterschiedlich gestaltet werden kann:
Leib- bzw. Zeitrente, Verkauf, eine Übergabe mit individuell vereinbarten Gegenleistungen mithilfe des Übergabevertrags, Schenkung oder die Überschreibung an eine Stiftung. Diese Wege unterscheiden sich bezüglich zeitlicher, sozialer und finanzieller Rahmenbedingungen.
Eine weitere Möglichkeit ist es, den Betrieb in eine gemeinsame Rechtsform zu überführen und ihn als Kooperationspartner auf gleicher Augenhöhe zu bewirtschaften. Dazu haben wir im Abschnitt “Unternehmensformen für gemeinsame Bewirtschaftung” Ideen gesammelt.
Verpachtung eines Gesamt- oder Teilbetriebs
Ein landwirtschaftlicher Pachtvertrag regelt die Überlassung einer landwirtschaftlich nutzbaren Fläche mit oder ohne Gebäude zur landwirtschaftlichen Nutzung gegen einen Pachtzins.
Der schriftliche Pachtvertrag kann bei der Bezirksbauernkammer gegen Leistung eines Kostenbeitrages erstellt werden. Pachtverträge können auf bestimmte oder unbestimmte Zeit abgeschlossen werden. Auch die Verpachtung von Teilbetrieben ist möglich, indem zum Beispiel nur ein Stallgebäude und zugehörige arrondierte Weideflächen gepachtet werden. Besonders zu beachten sind die Dauer der Pachtverträge und die vertraglichen Regelungen, die bezüglich Investitionen und Abnutzungen getroffen werden.
Eine kurze Pachtdauer (z.B. ein Jahr) kann als Vorbereitung für die Übergabe durchaus sinnvoll sein. Bei längerfristigen Pachtverträgen aber kann die Finanzverwaltung eine Betriebsaufgabe erkennen, nämlich dann, wenn zu erwarten ist, dass der/die Verpächter*in den Betrieb nach Auflösung des Pachtverhältnisses nicht mehr auf eigene Rechnung und Gefahr weiterführen wird.
Auch wenn die Pachtdauer sehr lange angesetzt ist, kann man nicht von einer Übergabe sprechen, solange kein Eigentümerwechsel erfolgt. Was Sie als Pächter*in zudem beachten sollten, sind die Bedingungen für das Ansuchen um die Neugründungs-Förderung (NeuFöG) bei einer späteren Übernahme.
Die Übergabe als vorweggenommene Erbfolge
Eine Hofübergabe ist auch eine vorweggenommene Erbfolge, weshalb die Ansprüche der weichenden Erb*innen der Übergebenden rechtzeitig geregelt werden müssen. Grundsätzlich haben die Kinder der Übergebenden nach dem Ableben ihrer Eltern Anspruch auf einen Pflichtteil. Der Pflichtteil von Kindern beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruches in Form von Geldleistungen.
Wird ein Hof an familienfremde Personen durch Schenkung oder unterhalb des Verkehrswertes verkauft, ist eine Besonderheit der außerfamiliären Hofnachfolge, dass die erbrechtliche Schenkungsanrechnung auf zwei Jahre nach der Übergabe befristet ist. Es ist wichtig, die Kinder derer Personen, die ihren Hof übergeben, in die Hofübergabe einzubeziehen.
Die Entscheidung, was mit der Erbschaft passiert, obliegt letztendlich denen, die ihren Hof zur Übergabe anbieten. Diese müssen sich vor einer Übergabe im Klaren sein, ob und was sie ihren Kindern an der Erbschaft zugestehen.
Nach Ablauf der zweijährigen Frist können die Kinder der Übergebenden keine erbrechtlichen Ansprüche mehr stellen. Auch die außerfamiliär Übernehmenden haben keine Forderungen der Erbinnen und Erben mehr zu erfüllen, wenn die Übergebenden nach der Übergabe noch mindestens zwei Jahre leben.
Verkauf, Leibrente oder Zeitrente
Wie bei jedem Kaufvertrag kann die Kaufpreiszahlung in Raten oder in Form einer Leib- oder Zeitrente erfolgen. Bei der Leibrente kann der Betrag monatlich oder jährlich eingehoben werden. Durch die Verpflichtung der Käufer*in zur Zahlung der Leibrente erwirbt diese das Eigentum am Vertragsgegenstand. Leibrenten werden üblicherweise bis zum Lebensende der Vertragspartner*innen ausbezahlt. Dadurch ist die Höhe des Kaufpreises nicht im Vorhinein fix festgelegt. Die Höhe der Leibrente kann sich am Wert des Betriebes und der Lebenserwartung der Verkäufer*in orientieren, aber auch frei vereinbart werden.
Im Falle einer Zeitrente wird die Rente nicht vom Leben einer Person abhängig gemacht, sondern auf einen von beiden Vertragsseiten festgelegten Zeitraum, in dem die Rente bezahlt wird. Auch hier können die Vertragsbegünstigten andere als die Verkäufer*in sein. Stirbt die Verkäufer*in innerhalb des Zeitrahmens der Zeitrente, wird die Rente für den Rest der Zeit an die Erb*innen bezahlt.
Der Verkaufswert ist in der Regel durch die Zeitspanne und die monatliche Zahlung festgelegt.
Bei Leib- als auch Zeitrenten können auch Einmalzahlungen vor oder nach dem Beginn der regelmäßigen Zahlungen vereinbart werden. Da es sich bei der Leib- und Zeitrente um ein Modell des Verkaufs handelt, sind auch hier Grundverkehrsregelungen der einzelnen Bundesländer zu beachten.
Eine Leib- oder Zeitrente wird meist dann gewählt, wenn es zwischen denen, die ihren Hof übergeben und den Hofübernehmenden auch in Zukunft Kontakt geben soll. Wenn die Hofübergabe aber ein Schlussstrich unter die Zeit als Landwirt*in sein soll und ein Neubeginn ansteht, wird evtl. ein Verkauf als Variante gewählt.
Stiften
Als Alternative zum Verkauf des Betriebes an Privatpersonen bietet sich die Übergabe des Hofes an eine Stiftung an. Dies kann durch Verkauf oder Schenkung erfolgen. Die Stiftung übernimmt das Eigentum und überlässt es den Hofnachfolger*innen zur Nutzung in Form von langfristigen Pacht- oder Baurechtsverträgen. Durch die Zwischenschaltung der Stiftung ist die landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht nur für eine, sondern für alle nachfolgenden Generationen sichergestellt – insofern die Stiftung die landwirtschaftliche Nutzung in ihrer Satzung festgelegt hat.
Des Weiteren können auch spezielle Vereinbarungen zur weiteren Bewirtschaftung des Betriebes festgelegt werden.
In Österreich stellt die Stiftung „Munus – Boden für gutes Leben” (Link: https://munus-stiftung.org/) die Nutzung von Grund und Boden sozial und ökologisch verträglich sicher. Sie übernimmt Liegenschaften durch Schenkung oder Kauf, um sie zu günstigen Bedingungen an Nutzer*innengemeinschaften zur Verfügung zu stellen. So wird Grund und Boden vor Spekulation geschützt und langfristig einer sinnvollen Nutzung zugeführt.
Der Übergabevertrag
Bei Abschluss einer Hofübergabe ist der Übergabevertrag ein wesentliches Dokument, bei dem es einige Sachen zu beachten gibt. Der Übergabevertrag ist ein sogenannter atypischer Vertrag, welcher im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt ist – umso wichtiger ist die genaue Ausarbeitung seiner Inhalte. Wenn bei Personen, die ihren Hof übergeben und Hofübernehmenden alle wesentlichen Punkte innerfamiliär besprochen wurden, der Inhalt also geklärt ist, kann man sich an ein/e Jurist*in wenden. Diese/r übernimmt die schriftliche Ausarbeitung und bringt den Vertrag zu Papier.
Im Übergabevertrag wird vereinbart, dass ein bäuerlicher Betrieb gegen bestimmte Gegenleistungen zur Sicherung des Lebensabends all jener, die ihren Hof übergeben, erfolgen wird. Dadurch unterscheidet er sich von einem Kaufvertrag, bei dem die Gegenleistung ausschließlich aus Geldleistungen bestehen. Als Gegenleistungen können im Übergabevertrag die Übernahme von Schulden und Lasten, Auszahlungen der weichenden Kinder, Wohnungs- und Ausgedingerechte, Betreuungsrechte oder Fruchtgenussrechte vereinbart werden.
Checkliste für den Übergabevertrag – siehe auch folgende Broschüre: LJOE_Broschuere_Ausserfamiliaere_Hofuebergabe
Benötigte Unterlagen: Grundbuchsauszug (z.B. beim zuständigen Bezirksgericht), Einheitswertbescheid (Finanzamt), ev. auch Grundbesitzbogen und Mappenkopie (Vermessungsamt), sowie Kreditunterlagen.
Besprechung aller wichtigen Fragen / Vertragspunkte: innerfamiliäre und außerfamiliäre Klärung
Auswahl der Vertragsverfasserin bzw. des Vertragsverfassers: aufgrund der Komplexität eines Übergabevertrages sollten professionelle Schriftenverfasserinnen bzw. -verfasser (z.B. Notarinnen bzw. Notare) in Anspruch genommen werden. Im Vorfeld werden oft im Zuge der Hofnachfolgeberatung –oder Prozessbegleitung Vertragsentwürfe vorbereitet, um die Zeit beim Notariats- oder Rechtsanwaltstermin möglichst kurz zu halten.
Vereinbarung über die Kosten der Vertragsverfassung: wird keine Vereinbarung über das Honorar für die Vertragsverfassung getroffen, bestimmt sich der Honoraranspruch (von Notarinnen und Notaren) nach dem Notariatstarif auf Grundlage des landwirtschaftlichen Einheitswertes.
Erstellung und gründliches Studium des Vertragsentwurfes: genaue Abklärung mit der Schriftenverfasserin bzw. dem Schriftverfasser über die Bedeutung und die rechtlichen Konsequenzen etwaiger Klauseln und Formulierungen
Beglaubigung der Unterschriften: Für die Eintragung ins Grundbuch sind die Unterschriften notariell oder gerichtlich zu beglaubigen.
Anzeige beim Finanzamt: Der Vertrag ist dem Finanzamt anzuzeigen. Nach Vorschreibung und Entrichtung der Steuern und Abgaben übersendet das Finanzamt die Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Eine grundverkehrsbehördliche Genehmigung ist bei der zuständigen Bezirksgrundverkehrskommission zu beantragen.
Grundbücherliche Eintragung: nach Vorliegen aller Urkunden, insbesondere Vertrag, finanzamtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, gegebenenfalls rechtskräftiger Bescheid der Grundverkehrskommission, etc. kann die grundbücherliche Durchführung beantragt werden. Diese Wege (Anzeige beim Finanzamt, Grundverkehrskommission, Grundbuch) werden üblicherweise von den Schriftenverfasserinnen bzw. -verfassern vorgenommen.


